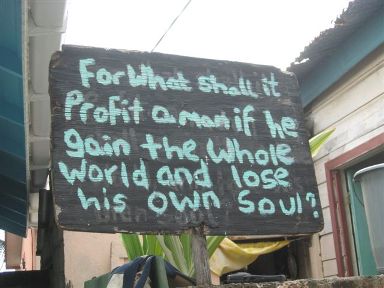Die zweiten 7 Wochen auf
St.Lucia
Teil 2
Ein guter Tag beginnt mit einer Mango
- das war schon auf Gran Canaria so.

Meine fixe Arbeit am Morgen ist es, die nächtens und tags
zuvor herunter gefallenen Mangos einzusammeln. Davon bringe ich
dann einen großen Kübel in die Küche –

wirklich eine schöne Arbeit. Die wissen gar nicht, wohin
mit den vielen Mangos. Ich biete freilich Unterstützung, aber mehr
als acht Stück am Tag vermag ich nicht zu verdrücken.
Was zu
weich ist bekommen die Kühe.

 Tiere auf Balenbouche: http://www.myvideo.at/watch/6625533 Tiere auf Balenbouche: http://www.myvideo.at/watch/6625533
Eine Treppe mit Stufen aus Grashalmen
Ich bin Volonteur auf Balenbouche. Die Arbeit muss mir
selber suchen. Es gibt zwei lange Stiegen hinunter zum Mühlrad der
aufgelassenen Zuckerfabrik.


Die Stufen sind aus dickem Bambus gemacht. Das hält ein paar
Jahre – und die sind jetzt gerade vorbei. Ich fälle ein paar lange
Bambus-Stecken und mache daraus die neuen Stufen.

Bambus ist ein Gras. Es wächst in Büscheln von ein, zwei
Metern Durchmessern. Hoch werden die Halme hier so 10 bis 20
Meter. Die dickeren Halme kommen auf 8 bis 10 cm im Durchmesser.
Wenn der Wind in die Bambus-Büscheln weht, und die Stangen
aneinander schlagen, dann gibt das laute Klänge. Die Idee, daraus
Musikinstrumente zu bauen, ist nicht zu überhören.

Balenbouche ist von 1770 bis 1940 eine
Zuckerrohrplantage gewesen.
Das
Zuckerrohr wurde vor Ort verarbeitet zu Zucker. 1840 ist das große
Wasserrad investiert worden.


Ich nehme an, dass es das Kanalsystem für das Oberwasser neu
dimensioniert werden musste und jene Gebäude gebaut wurden, deren
Reste noch zu sehen sind. Auch der Oberteil einer Destille und
viele andere Maschinenteile stammen wohl aus der Investition von
1840 Das sind die Spuren:


Teil einer Destille für Ölgewinnung und für Rum.



Altes Gemäuer


Große Behälter aus Kupfer und aus Gusseisen
Reste des
Kanalsystems, das zur Versorgung des Wasserrades benötigt wurde,
speisen nun einige Zierteiche:




Im vorigen Jahrhundert hat in Europa die Zuckerrübe an
Bedeutung gewonnen. Dadurch ist der Preis des Zuckers in der
Karibik verfallen. Arbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz. Damit
wird jener Sabotageakt in Verbindung gebracht, der 1940 das
Mühlrad zum Stehen gebracht hat. Die Situation der Arbeiter war
damit endgültig besiegelt. Inzwischen ist Gras über die Sache
gewachsen:





Das Rad hat einen Durchmesser von 25 Fuß, also etwa 7
Meter. Was das an Willenskräften bedurft hatte, so eine Anlage,
fern von England zu planen, die Einzelteile zu produzieren, zu
verschiffen, bis hierher zu transportieren, zusammenzubauen und
schließlich in Betrieb zu setzen!

Dieser Baum konnte an dieser Stelle erst nach der
Stilllegung der Zuckerfabrik gewachsen sein und somit ist er noch
keine 70 Jahre alt. Hohe, schmale Wurzeln verlaufen an der
Oberfläche des steinigen Bodens und von Mauerresten:




Und hier noch ein interessanter Baum, der Calabash-Baum.
Seine Frucht ist nicht essbar, doch die äußerste Hülle gibt schöne
und brauchbare Schalen:



Wie das mit Zuckerrohr vorbei war, hat man auf Balenbouche
andere Früchte angebaut und produziert: Zitronen, Bananen, Ingwer
Pfeffer, Kaffee, Kakao, Tabak, Baumwolle und Kokosnüsse . 1970 hat
Erik Lawaetz Balenbouche erworben. Das ist der Schwiegervater und
Großvater von den jetzigen Betreibern, Uta und ihre Töchter Verena
und Anitanja.
Heute gibt es hier auf 75 acreas, das sind 30
ha, die Landwirtschaft:


Rinder und Reitpferde

einen größeren Kräutergarten und Kokospalmen




Mango und Papaya. An eine eigenständige Bio-Gärtnerei ist
Land verpachtet. 1990 wurde begonnen, frühere Personalgebäude in
Gästehäuser umzubauen. Heute gibt es 4 Gästehäuser mit insgesamt
15 Betten


In diesem Haus sind früher Baumwolle, später Kokosnüsse
gelagert worden. Es ist heute der Gruppenraum, wo zum Beispiel
Yoga gemacht wird.




Gäste aus allen Hotels der Insel werden mit Autobussen zu
den Sehenswürdigkeiten gefahren, so auch nach Balenbouche. Sie
genießen den wild-natürlichen, gepflegten Park, schauen hinunter
aufs Wasserrad, werfen vielleicht einen Blick in eines der
Gästehäuschen.

Uta erzählt ihnen die Geschichte dieser „Heritage“,
womit Kulturerbe gemeint ist. Zum Schluss gibt es noch ein Glas
Mangosaft für jeden Besucher.

Die Hauptsaison in den Gästehäusern ist von Oktober bis
Anfang Mai. Das ist jene Zeit, wo es in USA, Kanada und UK kalt
ist. Die Regenzeit und die Zeit der Hurrikans beginnt im Juni und
endet im Oktober. Da sind in Balenbouche Volonteure willkommen –
weshalb ich hier sein kann. Es kommen auch im Sommer immer wieder
mal Gäste. Ich denke, da gibt es dann Nachsaison-Preise.
Hier werden gerne Hochzeiten gefeiert. Auf Wunsch kommen Priester
oder Pastoren ins Haus. Noch im Juni werden hier ein aus
Martinique stammendes Paar Hochzeitsfest halten. Man erwartet 400
Gäste. Dazu wird es ein eigenes Zelt geben. An der Verkabelung für
die Beleuchtung des Parks, der Gebäude und der Bäume arbeiten wir
derzeit.
Die Menschen auf Balenbouche
Drei Männer arbeiten außer Haus. Hier ist Mumu, beschäftigt mit
dem Herauskratzen von Kokosflocken.

Er ist der, der auf Palmen klettert, um Kokosnüsse zu pflücken.
Baban sehe ich viel im Garten arbeiten. Immer hat er einen
breitkrempigen Strohhut auf.

Zum Fototermin habe ich ihn gebeten, ihn abzunehmen.
Uta schätzt den Baban sehr. Er ist ihr seit vielen Jahren ein
treuer, selbstbewusster, loyaler Helfer, erzählt sie mir. Baban
habe ein wunderschön gepflegtes Häuschen. Seit einigen Jahren sei
er Witwer. Er besitzt einige Kühe. Die laufen mit in der Herde auf
den Weiden von Balenbouche. Baban wird im August 69. Fast jeden
Tag arbeitet er seine 8 Stunden.
Wenn mit der Motorsense
gemäht wird, dann ist es meist der Oliver

Es gibt zwei Frauen. Die sind für die Sauberkeit in den
Gästehäusern, im Haupthaus und in der Küche zuständig.
Hier
sitzt die Familie Lawaetz mit Gästen beim Spätstück:

von links: Viki, ein Gast aus Kanada/Trinidad, sie verdeckt
ihren Ehemann; dann Uta Lawaetz, Tochter Verena Lawaetz, ein
Mädchen aus dem Freundeskreis der Familie, Tochter Anitanja
Lawaetz.

Von rechts: der zuvor verdeckte Ehemann Mike, dann wieder
die Viki, ich/Volkmar, ein Freund des Hauses mit kleiner Tochter
und Verena.

Anitanja, die jüngere Tochter von Uta veredelt die
Kokosflocken zu Massageöl. Die Flocken werden mit Wasser versetzt
und fermentiert. Nach einigen Tagen ist das Öl heraußen aus den
Flocken und hat sich abgetrennt vom Wasser. Anitanja massiert
selbst damit und verwöhnt Gäste, die das möchten. Zu einer ihrer
Arbeit zählt das Herstellen von Schmuckketten.

Ich sehe Verena die Besucher im Gelände herumführen, beim
Kochen, Servieren und viel am Computer. Sie überarbeitet soeben
den Internetauftritt
www.balenbouche.com
Uta kommt aus Deutschland. Ihre
Schulzeit hat sie in Tirol verbracht. Sie hat ursprünglich
Schreinerei gelernt, sich dann zur Innenarchitektin weiter
gebildet und als solche gearbeitet. Sie hat Balenbouche zu dem
gestaltet, was es heute ist. Anfang der 90er Jahre kommen erstmals
Gäste. Sie beziehen frühere, dafür umgebaute Personalhäuser.


Bei Uta laufen alle Informationen zusammen und sie verteilt
die Arbeit – oder macht sie selbst: Kochen, servieren, reparieren,
Holz bearbeiten, Stöckelpflastersteine setzen, Gräben ziehen,
Elektroinstallationen, Machete schleifen ----.
Wie kommt man an die Kokosnüsse auf den Palmen heran?


Der Mumu klettert wie ein Affe hinauf, verrät mir Uta.
Das, worum es bei den Kokosnüssen hier geht, ist das Wasser in der
noch grünen Frucht. Es ist völlig keimfrei. Man könnte es sich
direkt ins Blut spritzen. Den Versuch unterlasse ich, denn gerne
führe ich diese klare, nur leicht süßliche Flüssigkeit über meine
Geschmackszellen im Mund in den Körper. Ebenso unaufdringlich
wohlschmeckend ist das zarte, weiße Fruchtfleisch. Bei jüngeren
Früchten ist es noch gelee-artig, daher wird es „jelly“ genannt.
Erwischt man eine schon sehr reife Nuss, dann wird es hart zum
Beißen.
Mumu ist taubstumm. „Die Menschen hier sind nicht
freundlich zu den Behinderten. Hier auf Balenboushe ist er
beschützt. Darum kommt er auch immer wieder gerne. Er hat ein
gutes Herz“, sagt Uta. Die Verständigung mit ihm ist ziemlich
klar. Daumen nach oben heißt „Ja“, den Kopf schräg in die linke
Hand gelegt, Augen geschlossen, heißt „morgen“.
Uta hat bei
ihm eine Kokosnuss bestellt für mich. Er überrascht mich damit,
als ich verschwitzt und ziemlich durstig die Stufen der Treppe
erneuere, die zur Mühle hinunter führt. Mit der Machete schlägt er
kleine, kalottenartige Stücke von der äußeren Hülle der Nuss ab.
Zuletzt macht er ein Loch – und ich darf den Mund ansetzen zum
Trinken. Ich reiche ihm die leer getrunkene Nuss. Mumu schlägt sie
mit zwei kräftigen Hieben entzwei, dann wird noch ein Löffel
abgehackt. Ich schlürfe das weiße, zarte Fruchtfleisch ein. Mit
beiden Daumen nach oben, gebärde ich mich begeistert. Linker
Zeigefinger auf ihn gerichtet, Kopf leicht schräg, fragende Augen,
mit den Fingern der rechten Hand krabble ich einen imaginären
Palmenstamm hinauf. Er nickt heftig. Ich neige meinen Kopf auf die
andere Seite, hol meinen imaginären Fotoapparat hervor und knipse
ab. Meine Augen sind fragend-bittend. Mumu stimmt mit beiden
Daumen zu! Dann Kopf zur Seite in die Hand gelegt, Augen zu. Ich
bestätige, dass ich ihn verstanden habe und forme mit den Lippen
ein deutliches „Tomorrow“. Mumu zeigt mit einem Daumen nach oben –
abgemacht.
Früh am Morgen steht Mumu da. Ich knipse fragend.
Mumu nickt und richtet den Daumen nach oben. Alles klar für den
Fototermin! Mumu umklammert den Stamm nicht, wie wir das beim
Maibaumkraxeln tun. Seinen Rumpf stemmt er mit den Beinen weg vom
Stamm, die Arme sind auf Zug. Wie die Artisten im Zirkus „Afrika –
Afrika“. Schritt um Schritt und schon verschwindet er oben im
Schopf der Palme. Sieben Nüsse fallen zu Boden. Dann kommt Mumu
wieder zum Vorschein. Er klettert herunter, wie vorher hinauf.
Während Mumu die Nüsse zum Trinken aufhackt, versuche ich in
seiner Technik die Palme zu besteigen. Weil um 20 kg zu schwer,
scheitert mein Vorhaben.
 Kokosnussernte: http://www.myvideo.at/watch/6625522 Kokosnussernte: http://www.myvideo.at/watch/6625522
Es tagt auf Balenbouche

So wie abends mit Einbruch der
Dämmerung es langsam immer lauter wird von Insekten und anderem
Getier auf den Bäumen, so wird es morgens stiller und stiller. Die
Frösche gehen wohl bald nach Mitternacht schlafen, denn beim
ersten Wasserlassen höre ich sie nicht mehr. Auch der Klack-Klack
ist in der Morgendämmerung nicht mehr zu hören. Was langsam
ausklingt, wenn es schon fast heller Tag ist, sind die
Schellenglöckchen.
Nun höre ich wieder das Meer deutlich
rauschen. Die Steilküste ist etwa 20 Meter hoch. Das hält den
Schall ab. Doch es gibt einen kleinen Bach. Zur Regenzeit ist er
wohl ein Fluss. Der hat ein tiefes und weites Tal in den Sandstein
und das Konglomerat gegraben – daher der Name „Balenbouche“, auf
deutsch „Walfischmaul“. Durch dieses Maul wird das Rauschen im
ganzen Paradiesgarten hörbar. Es weckt Unruhe in mir.
Einmal bin ich unten gewesen. In der Bucht steht eine kleine
Insel. Ja, eine stehende Insel, denn das Ufer bricht nach allen
Seiten steil ab, ausgewaschen von der Brandung. Die Wellen brechen
gewaltig heran, auch ans Festland. Sie haben im Laufe der Zeit
eine ziemlich steile Sandküste aufgebaut. Die endet dann am Fuße
der senkrechten Konglomerat-Wand. Beim Schwimmen merke ich es
gleich: Es hat hier eine starke Strömung nach west. Ich spute
mich, wieder ans Ufer zu kommen, denn an der nächsten Ecke zieht
das Wasser hinaus in die weite Welt. Dazu fehlt mir im Moment ein
Schiff. Mit dem Meer ist hier nicht zu spaßen. Hier lässt, das
selbst formlose, jede Form annehmende Wasser, was erahnen von
seiner unheimlichen, verformenden Gewalt.




 Mehr Meer: http://www.myvideo.at/watch/6625542 Mehr Meer: http://www.myvideo.at/watch/6625542
Diese unheimliche Stimmung kommt in mir auf, wenn ich noch
im Bett dem Rauschen lausche. Ich sollte wohl wieder einmal nach
unten gehen, vor Ort dem Walten der Gewalten Augen und Ohren
öffnen.
Und dann die Rinder – keine zehn Meter von meinem
Haus stehen sie auf der Weide und fangen an zu muhen. Manchmal
schon um sechs Uhr, spätestens aber um sieben. Sehr anhaltend,
klagend und zugleich einfordernd – das ist freilich meine
Interpretation. Ich sehe mich veranlasst, mich mit zwei großen
Eimern in den Mango-Garten zu begeben. Die überreifen,
angeschlagenen und angefressenen für die Kühe, die festen Früchte
für die Küche. Die Kühe freuen sich, aber sie drängeln nicht, wie
Schafe, Ziegen oder Hühner, sie quietschen auch nicht wie Schweine
und sie beißen nicht wie Hunde. Nein, eine Kuh, wenn sie mich mit
dem Eimer kommen sieht und vielleicht auch mein „kuhli-kuhli“
hört, wendet mir erst mal den Kopf zu. Dann beginnt sie Fuß vor
Fuß zu setzen und trottet in aller Ruhe zur Futterstelle. Andere
Tiere folgen. Eine Kuh erkennt nicht, dass für sie weniger bleibt,
wenn auch andere vom gleichen Haufen fressen.
Vor ein paar
Tagen haben Baban und Mumu den Kanal geputzt. Jetzt ist wieder
Wasser in den Teichen beim Mango-Garten. Die Seerosenblüten liegen
an der Oberfläche. Manche ragen ein wenig heraus. Es ist wieder
Leben im Teich. So friedlich auch kann Wasser sein.

Wanderung am Strand
Eine Rundwanderung im Regenwald hatte ich im Sinn,
als ich gestern morgens um halb 10 an der Hauptstraße stehe. Die
Sammel-Taxi seien am Sonntag rar, hatte mich Uta gewarnt.
Mich nimmt bald eines auf. Der Fahrer hat seinen
Enkel neben sich. Der darf das Lenkrad führen, Schlaglöchern
ausweichen, Kurven schneiden – alles lernt der Kleine. Drei
Kilometer vor Vieux Fort heißt er mich aussteigen, der Großvater.
Nein, er will kein Geld. Ich bin offenbar Gast bei einem
Familienausflug gewesen. Nach wenigen Schritten hält ein Auto für
mich zur letzten Etappe nach Vieux Fort, wo die Busse nach Norden
fahren.
Ich bin der erste Fahrgast im Taxi-Bus nach Castries. Es dauert
lange bis ein Zweiter kommt. Ein Kokosnuss-Schlächter hat mich
erspäht und bringt mir eine grüne Frucht, fast geöffnet. Oh ja,
gerne. Ich krame mein Geld aus der Hosentasche. Inzwischen habe
ich mir abgewöhnt, die ganze Geldbörse mitzunehmen mit allen
Scheckkarten, ÖBB-Vorteils-Karte, Mitgliedskarte vom Autoklub usw.
Ich nehme nur das mit, was ich zu verbrauchen gedenke und schiebe
es, wie in ganz Westindien der Brauch, in die Hosentasche. Die
Scheine, spätestens die des Wechselgeldes, ziehe ich da genau so
verknüllt heraus, wie das hier alle tun. Echt cool.
Der Bus-Fahrer beginnt zu schimpfen mit mir. Ich nehme an, er
fürchtet, dass ich die Kokosmilch im Bus trinke, was wie rauchen
und essen verboten ist. Der hat einen schlechten Tag heute, halte
ich für sehr wahrscheinlich, und beschließe, nicht mit ihm zu
fahren.
Ich lenke meine Schritte auf die Straße, die in den
Norden führt. Vielleicht nimmt mich wer mit? Da lockt mich der
nahe Strand. Hier im Süden sind zwei Inseln vorgelagert, die
Marien-Inseln. Sie sind Naturschutzgebiet.



Trotz der Inseln gibt es starke Wellen am Sandstrand. Ich
ziehe die Schuhe aus. Das mag ich, dieses Anrollen und Auslaufen
der Wellen am flachen Sandstrand! Und dann so halb im Wasser, halb
im Trockenen dahin waten. Ich komme zu einem Sporn, wo der Strand
im spitzen Winkel nach Norden wendet. Hier laufen Wellen aus zwei
Richtungen aufeinander – ein interessanter Ort.


Ich begegne einem weißen Mann. Weiße sind hier seltener als
Schwarze im Straßenbild von Linz. Man nickt einander zu, oder
spricht sich an. Woher, wohin? Der Andere ist aus Florida und ich
bin Österreicher. Wir wünschen einander „enjoy the rest of the
Sunday“.

Diese Absperrung hatte ich nicht zu deuten gewusst.

Und so gerate ich ins Gelände einer
All-inklusive-Nobelherberge.




Mit einem Kleinbus komme ich nach Micoud. Hier sind alle
Menschen wieder freundlich zu mir.





Ich schlendere durch das Städtchen, kauf mir was zum Essen
und zum Trinken. Ein richtiges Gasthaus gibt es hier nicht. Das
übliche gegrillte Hühnerhaxl ist mein Lunch.
Weiter komme
ich heute nicht mehr. Der Regenwald muss warten.
Ob ich wirklich weiß bin, wollen sie wissen.
Ein Kleinbus fährt vor in Balenbouche. Dem Beifahrersitz entsteigt
eine gut proportionierte schwarze Mami. Aus den hinteren Sitzen
purzeln Kinder jeglichen Alters. Die Frau holt Mango-Früchte ab
für den Verkauf am Markt. Nicht jene Mango, die ich morgens vom
Boden auflese – die sind alle schon so reif, dass sie vorwiegend
versaftet, oder sehr bald verzehrt werden. Für den Verkauf eignen
sich nur die gepflückten Früchte.
Die im Auto verbliebenen
Kinder rufen und winken mir fröhlich zu, als sie mich sehen. Ich
geh ahnungslos nahe an den Bus heran – da begrapschen die Kleinen
meinen bloßen Oberkörper und haben ihren Jubel damit. Ich lasse
sie gewähren. Sie haben ein kindliches Vergnügen, sich mit den
eigenen Händen zu überzeugen, wie da wirklich nichts Weißes
abgeribbelt werden kann.

In Canaries und meine fluchtartige Abreise von dort
Meinen kleinen Rucksack am Rücken, Fotoapparat schussbereit in
der Tasche, so sieht man mich durch Canaries ziehen. Menschen
sitzen vor ihren schmucken Häusern, andere vor in die Jahre
gekommene Holz- und Wellblechverschläge. Da geht kein Fremder
durch, ohne gesehen zu werden!
Aus zehn Meter Entfernung ruft mir ein junger Mann zu, woher ich
komme. Ich erzähle ihm von mir. Was er da mache, frage ich ihn.
Aha, eine Art Tagesheimstätte für Rastafari-Kinder ist das hier.
Ich ziehe weiter zum Fischerhafen. Da ist eine Anlage mit vielen
Fischerzeug-Hütten im fertig werden. Es hat schon Leben hier.
Männer spielen lautstark Domino. Junge Burschen lungern herum.
Einer liegt in einer Scheibtruchen (hochdeutsch Schiebkarre). Ich
finde das fotogen und lass mir das fotografieren erlauben. Dann
ein Foto von mir mit Scheibtruhe und dem Burschen drin.

Das schafft Kontakt – die Burschen gehen mich um ein Getränk an.
Eigentlich nicht jene Ebene, die ich schätze. Ich gebe dem einen
10 EC-Schein, zu einem Getränk für jeden von uns. Er verschwindet
– und kommt nicht wieder. Über den Tisch gezogen, erkenne ich.
Doch man darf das nicht so eng sehen. „Lateralschaden“, wie die
Amerikaner sagen, wenn es Tote gibt bei einer ihrer militärischen
Friedensaktionen. Sowas geht halt manchmal schief.
Vor einem Haus lässt mich ein Schild nachdenklich werden:
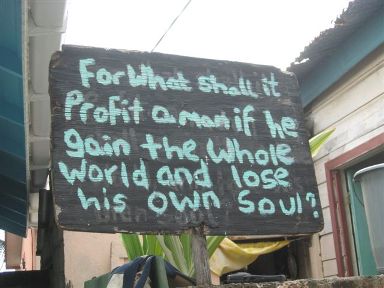
For what shall it profit a man if he gain the whole world and lose
his own soul?
Wofür soll das gut sein sein, wenn ein
Mann die ganze Welt gewinnt und seine eigene Seele
verliert?
Eine Frau tritt aus dem Haus – ob mir der Spruch gefällt, fragt
sie. Ich muss gestehen – ja.
Dann komme ich zu einer Gruppe jüngerer Frauen. Die sagen mir
gleich von vornherein, fotografieren nur gegen Geld. „You have
money“, sagen sie mir auf den Kopf zu. „I’m not a rich man“,
verwehre ich mich. Wenn ich ein reicher Mann wäre, würde ich nicht
nach Canaries kommen, schon gar nicht im Sammeltaxi und mit
Rucksack, allenfalls mit einer Reisegruppe aus dem
All-Inclusiv-Hotel oder Golf spielen. Die Frauen sind gnadenlos.
Sie deuten auf die richtige Stelle meiner Hose und bestehen
darauf: „You have money“. „Was ich habe, dafür habe ich viel
gearbeitet“, versuche ich mich als Streetworker. „Und außerdem
habe ich es vom Behalten und nicht vom Hergeben“, denke ich mir im
Stillen, „und selbst wenn ich all mein Hab und Gut im Dorf
verteilte, es würde euch wenig helfen und ich wär dann so arm wie
ihr“, sinniere ich leise weiter. „For my Baby“, meint eine andere.
„Wo ist der Vater – der hat dafür zu sorgen!“ versuche ich es mit
der Moral. Sie weiß sofort die richtige Antwort: „The father is
died“. Es ist alles vergebens. Die Fronten haben sich verhärtet.
Ich gehe.
Die Baby-Mutter folgt mir. Das Baby hat sie jemand anderem
überlassen (vielleicht der wirklichen Mutter?). Und wenn sie
wirklich recht arm ist, und der Vater wirklich tot ist? Die Lage
hat sich entspannt – gebe ihr einen 20-EC-Schein. Sie bietet sich
an, mir das Dorf zu zeigen. Schon sind wir bei einem kleinen
Häuschen, wo auf ihr Klopfen eine alte Frau heraustritt. „Meine
Mutter“, erklärt sie mir. Ich dürfe eintreten, sagt die
Baby-Mutter. Das wird mir zu eng. Ich blicke auf die Uhr und
täusche größte Eile vor: „My bus!“ heuchle ich überrascht, „bye!“
An der Stelle, wo ich den Bus erwarte, entdeckt mich eine
ziemlich heruntergekommene Frau. Sie schiebt sich hautnah heran
und erzählt mir was von ihrer Wohnung. Sie scheint mir unter
Drogen zu sein. Die Arme ist alles andere als von irdischer
Schönheit beschenkt. Ein einziger Zahn noch schmückt ihren Mund.
Sie bettelt nicht bloß, sie meint wohl, sie habe noch was
anzubieten von ihrem Körper, das wovon sie möglicherweise immer
wieder erfahren hat, dass es das einzige ist, um zu Zuwendung
jeglicher Art zu kommen. Ich versuche ein wenig, sie in mein Herz
zu nehmen und lehne freundlich aber bestimmt ab.
Der Bus kommt. Das war Canaries.
Die letzten Tage auf Balenbouche
Am 20. Juni – wenn ich nicht mehr da bin – wird ein Paar
aus Frankeich/Martinique hier groß Hochzeit halten. Es werden 400
Gäste erwartet. Es gibt große Ereignisse, die werfen ihre Schatten
voraus. In diesem Fall werfen Scheinwerfer ihr Licht voraus.
Ein Bagger hat kleine Gräben gezogen für elektrische Leitungen zu
den Scheinwerfern, die einige Dutzend an der Zahl aufgestellt
werden sollen. Ich erlebe noch die Beleuchtungsprobe. Ist der
ganze Park schon am helllichten Tag zauberhaft, so zeigen Bäume,
Sträucher und Bambusstangen im Spiel von Licht und Schatten ein so
unwirkliches Bild, wenn ich mich dem hingebe, lässt es sonst nicht
gekannte Gefühle aufkommen. Das macht dann jene verklärte
Stimmung, die von dem Vorbereitungs-Komitee aus Martinique
offensichtlich gewünscht wird.
Ich muss der Arbeit nicht
mehr so nachlaufen wie zu Beginn. Inzwischen läuft sie mir nach.
Die Gräben wollen wieder zugeschüttet werden. Da kommen dann
Rasenziegel drauf. Zum Teil muss ich sie selber ausgraben und
herbeischaffen. Später bringt mir der Mumu die Rasenziegel. Es
gibt auf Balenbouche keine Scheibtruchen (Schiebkarren), sondern
nur diese Tücher. Da wird draufgelegt, was bewegt werden soll und
dann heißt es ziehen:

Das Installieren der Scheinwerfer und das Verdrahten
und Anschließen ans vorhandene Netz ist Chefsache. Hier die Uta
bei der Arbeit:

Ich qualifiziere mich als Plattenleger. Nachdem sie mein
Werk gesehen hat kommt Uta ins Schwärmen über die hier wieder
einmal sichtbar gewordene europäische Sorgfalt bei solchen
Arbeiten,. Ich hab es freilich leichter, als jeder bezahlte
Arbeiter, denn ich kann mir so viel Zeit lassen, bis es so gut
gelungen ist, dass ich zufrieden bin damit:

Es wird ein letztes mal gemäht, Laub gerecht und herab
gefallenes Astwerk verräumt. Die Anitanja beginnt Blumenschmuck zu
arrangieren. Ein Esel trifft ein. Auf ihm soll die Braut von ihrem
Vater herein geführt werden. Die drei üben schon. Der Esel verhält
sich sehr kooperativ. Über die Symbolik zu lachen fällt mir ein
wenig schwer. Soll das zeigen, dass die Frau nun einen Esel
gefunden hat, auf dem sie künftig das Leben reitet? Und das Bild
der Jungfrau Maria wie sie nach Ägypten reist – assoziiert nicht
gerade die Aussicht auf eine sinnliche Ehe.
Während in
Balenbouche schon das Partyzelt aufgestellt wird...

...bringen Verena und ihr Freund George mich nach
Soufriere. Mit dem Sammeltaxi über die berge nach Castries und
weiter zum Flughafen. Wir machen noch Halt beim Kokosnussmann.

Ein letzter Schluck aus der Kokosnuss.
Ich fliege
über Barbados nach Canouan, einer Insel der Grenadinen, zu St.
Vincent gehörend. Hier wird mich Georg auf seiner Segelyacht
aufnehmen und mit mir und seiner Familie durch die Grenadinen nach
Trinidad segeln.
zur Fotogalerie
zur Startseite
|